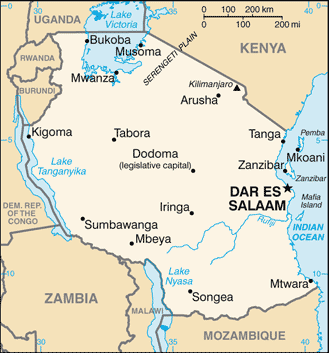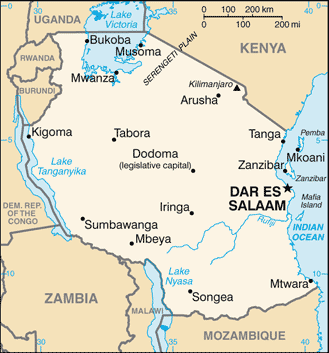Lange habe ich überlegt, was ich noch zum Thema schreiben könnte, bis ich auf einen interessanten Beitrag im Mikocheni-Report gestoßen bin (dessen Betreiberin Elsie Eyakuze im aktuellen East African außerdem einen leidenschaftlichen Love letter to Tanganyika veröffentlicht hat).
Elsie hat zuletzt über die kürzlich in Dar es Salaam abgehaltene TEDxDar-Konferenz gebloggt, u. a. über den Vortrag des Parlamentariers January Makamba, in dem dieser exemplarisch zwei Tansanierinnen gegenüberstellt: Zawadi und Vanessa. Diese exemplarische Illustration, die – mit Einschränkungen – auch auf viele Nachbarländer Tansanias übertragbar ist, zeigt wie unterschiedlich „Frau sein“ in Afrika heute aussieht.
Während Zawadi (zu dt. „Geschenk“) die „typische Tansanierin“ repräsentiert, steht Vanessa für die moderne Tansanierin, zugehörig zu jenen 20% des Landes, die die höchsten Einkommen erwirtschaften.
Zawadi ist 17, isst selten Fleisch oder Fisch, geht überallhin zu Fuß, hat kein Handy, aber sieben Geschwister, hatte mit 17,5 Jahren zum ersten Mal Sex, hat mit 19 einen 5 Jahre älteren Mann geheiratet, bekommt ihr erstes Kind mit 19,5, ihr letztes mit 36 Jahren und lebt in einer ländlichen Gegend als Kleinbäuerin.
Vanessa wiederum wird studieren, lebt in einem Haus mit 4 Schlafzimmern, fährt fast überall mit dem Auto hin, hat eine 78%ige Chance auf bezahlte Arbeit, besitzt mehrere Handys oder Smarthphones, hat den ersten Sex mit 18.5, schließt ihr Studium mit 21 Jahren ab, heiratet mit 23 einen 3 Jahre älteren Mann, bekommt dann ihr erstes und mit 32 Jahren ihr letztes Kind.
Während es im Vortrag darum ging, welche Auswirkungen auf das Konsumverhalten es haben würde, die Zawadis Tansanias auf eine Stufe mit den Vanessas zu bringen (etwa was Wasser- und Energieverbrauch betrifft), greife ich diesen exemplarischen Vergleich der beiden Frauen einfach einmal heraus, weil ich darin eine griffige Illustration sehe, um das europäische Bild der „afrikanischen Frau“ ein wenig zu ergänzen.
Das europäische Stereotyp der „afrikanischen Frau“ sieht diese arm, gebückt, mit vielen Kindern, unterdrückt und chancenlos. Das dies nicht so ist, damit beschäftigen sich EthnologInnen, z.B. schon recht lange (mein persönliches Aha-Erlebnis hierzu war Henrietta Moores 1986 veröffentlichte Studie „Space, Text and Gender“ über die Marakwet in Kenia). Es lässt sich nicht abstreiten, dass viele afrikanische Frauen unter exremen Bedingungen leben, gleichzeitig aber sind die Lebenswelten der Frauen auch extrem vielschichtig.
Es gibt viele Zawadis, aber immer mehr Vanessas und noch viel mehr dazwischen. Ich selbst habe in Tansania zu einem verwandten Thema geforscht; darüber welches Potenzial die Zunahme von gemeinnützigen Organisationen für Frauen mit sich bringt. Viele Frauen gründen und betreiben sehr erfolgreich solche Organisationen und schaffen sich damit Bereiche der beruflichen Professionalisierung und Einkommensmöglichkeiten.
Meine Arbeit ist nun einige Jahre alt, aber ich denke, die Ergebnisse dürften immer noch haltbar sein: Frauen in Tansania und anderen afrikanischen Ländern erarbeiten sich auch hier immer mehr gesellschaftliche Teilhabe (neben ihrer ohnehin oft bedeutenden Rolle innerhalb der Familie).
Es ist daher sicher keine allzu kühne Vorausssage, davon auszugehen, dass in den meisten afrikanischen Gesellschaften der Anteil der Zawadis ab- und jener der Vanessas zunehmen wird. Was das wiederum für das Konsumverhalten und den Rohstoffverbrauch bedeutet, wird zu diskutieren sein – aber das sollte eigentlich eine Herausforderung sein, die man gerne lösen will, denn gerade in der Entwicklungszusammenarbeit wird man nicht müde zu betonen, welch‘ wichtige Ressource die Frauen sind. Ich denke, dass sich hier in den kommenden Jahren vieles tun wird – so, wie sich auch in den Jahren und Jahrzehnten bisher schon sehr viel getan hat.
Dennoch täten gerade die westlichen Organisationen und Medien gut daran, ihr Frauenbild einmal zu hinterfragen und Frauen nicht primär als passive Betroffene wahrzunehmen, sondern vielmehr als Akteurinnen, die gewillt sind, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen; die nicht als Opfer bemitleidet, sondern als Handelnde unterstützt werden wollen.