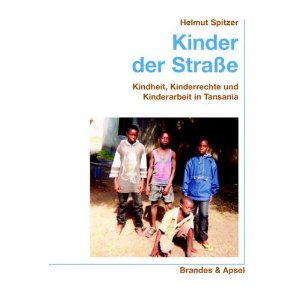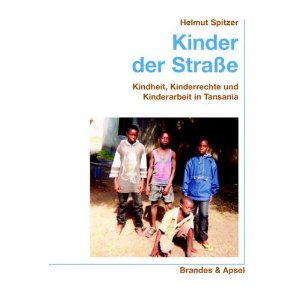Schon lange ist eines der vorherrschenden Themen in der EZ die Annahme, dass Mädchen und Frauen besonders benachteiligt und daher besonders gefördert werden müssen. Die Episode „Gender and Development“ der Podcast-Reihe Development Drums, erschienen am 10. August, (Podcast zum Download und als Transkript erhältlich, beides auf Englisch) beleuchtet dieses Thema auf spannende Weise und aus Expert_innensicht näher. Owen Barder vom Centre for Global Development spricht mit Andrea Cornwall, IDS University of Sussex und Prue Clarke vom Journalismus-Projekt New Narratives, über Gender, Empowerment und die Zukunft der EZ.
Mädchen und Frauen statt Gender – warum eigentlich?
Ich möchte keine vollständige Zusammenfassung wiedergeben, nur einige zentrale Punkte, die ich im Hinblick auf die aktuellen weit verbreiteten Ansätze zur Mädchen- und Frauenförderung in der EZ wichtig finde. Derzeit herrscht in weiten Teilen der EZ-Welt Einigkeit darüber, dass Mädchen- und Frauenförderung eine wichtige Maßnahme zur Armutsminderung ist. Dazu gehören etwa Programme, die die Einschulungsraten von Mädchen steigern sollen oder Frauen Zugang zu Mikrokrediten gewähren.
Ihnen zugrunde liegt i.d.R. die Annahme, dass Mädchen, die besser gebildet sind oder Frauen, die ein (höheres) Einkommen erzielen, eine bessere Stellung in ihrer jeweiligen Gesellschaft erreichen können.
Aber ist das wirklich so einfach? Und wirkungsvoll? Nicht unbedingt, sagt z.B. Andrea Cornwall, vor allem, wenn Jungen und Männer dabei nicht einbezogen werden und – ein wesentlicher Punkt – fundamentale strukturelle Ursachen der geschlechterbasierten Diskriminierung außer Acht gelassen werden. In einem Beitrag für den Guardian hatte Cornwall dies auch im März dieses Jahres thematisiert.
Cornwall kritisiert die derzeit populären Ansätze, die propagieren, durch Förderung von Individuen deren bestehende gesellschaftliche Diskriminierung abbauen zu können, ohne jedoch die strukturellen Ursachen von Benachteiligung zu benennen und mit in die Interventionen einzubeziehen. Etwa, Mädchen den Schulbesuch ermöglichen oder Frauen Zugang zu Mikrokrediten, aber darüber hinausgehend hinterfragen, warum Mädchen seltener zur Schule gehen oder inwieweit Kredite zu einer langfristigen Stärkung der gesellschaftlichen Position von Frauen beitragen (können).
In anderen Worten: Zu oft werden Symptome bekämpft, anstatt die tiefergehenden Ursachen zu benennen und zu bearbeiten.
Ein Beispiel Cornwalls für eine gegensätzliche Vorgehensweise ist der Kampf gegen weibliche Genitalbeschneidung in Westafrika. Erfolgreiche Ansätze konzentrieren sich nicht auf die Betroffenen alleine, sondern vor allem auf deren gesellschaftliches Umfeld und schaffen es, den Dialog der Angehörigen aller Alters- und Geschlechtergruppen einzurichten und aufrechtzuerhalten.
Ist „Empowerment“ heute eher „Empowerment light“?
Der Empowerment-Ansatz, seit rund zwei Jahrzehnten wichtiges Konzept zur Stärkung der Rechte und Positionen von gesellschaftlich benachteiligten Gruppen (insbesondere „Frauen“ in vielen Fällen), könnte hier ein wichtiger Wegweiser sein. Angesichts der beschriebenen eindimensionalen Ansätze ist er in vielen Fällen eben nur noch „empowerment light“, meint Cornwall.
Wirkliches Empowerment würde den Fokus wieder stärker auf „power“, also „Macht“ legen und könnte z.B. in Form der Unterstützung der verschiedenen Frauenbewegungen vor Ort in den jeweiligen Ländern geschehen. Auch gibt es eine Reihe von Aktivis_innen-Fonds und internationalen Lobbyorganisationen, deren Arbeit unterstützt werden könnte, denn nur so können fundamentale Machtunterschiede, die der Diskriminierung von Mädchen und Frauen zugrunde liegen, wirksam bekämpft werden.
Die results agenda und das Projektzyklusdenken
Das, und hier stimme ich Andrea Cornwall absolut zu, ist im gegenwärtigen Kontext der EZ eher schwierig. Cornwall spricht sich sehr stark gegen die gegenwärtige results agenda aus, in der in der EZ vor allem darauf geschaut wird, welche (quantifizierbaren) Ergebnisse innerhalb einer bestimmten Zeitspanne erreicht werden können.
Zudem muss dies in relativ kurzen Zeitabständen geschehen, damit auch nachgewiesen werden kann, was bestimmte Mittel (und es handelt sich hier i.d.R. um Steuergelder oder aber um Spenden) bewirkt haben. Daher wird in sehr kurzfristigen 2 bis 3-jährigen Projektzyklen gedacht wird, mit welchen sich zwar kurzfristige Ziele erreichen lassen (über die gut berichtet werden kann), tiefgreifende strukturelle Änderungen hingegen benötigen aber Zeit.
So wird sich wohl erst einmal nichts ändern, andererseits ist es auch das Wesen der Entwicklungswelt, dass sich über einen längeren Zeitraum gesehen, doch vieles ändern kann und Organisationen, ihre Konzepte und Ansätze sich ständig wandeln. Kurzfristig aber wäre es schon wünschenswert, wenn wir wieder etwas wegkämen von der reinen Mädchen- und Frauen- hin zu einer Gender-Agenda.